Abolitionistische Velotour durch Bern
Im Rahmen des Abolish!-Politmai besuchten wir am 15. Mai verschiedene Institutionen in Bern, die es abzuschaffen gilt: Polizei, Lager, Armee, Knäste und Gerichte. Die geplante Velotour wurde zu einer Spontandemo ausgebaut als Reaktion auf die Durchsuchung des «Anstadt»-Wagenplatzes und in Solidarität mit der gleichzeitig stattfindenden Kundgebung gegen Elbit Systems. Zu jeder Station wurde ein Text verfasst und aufgenommen.
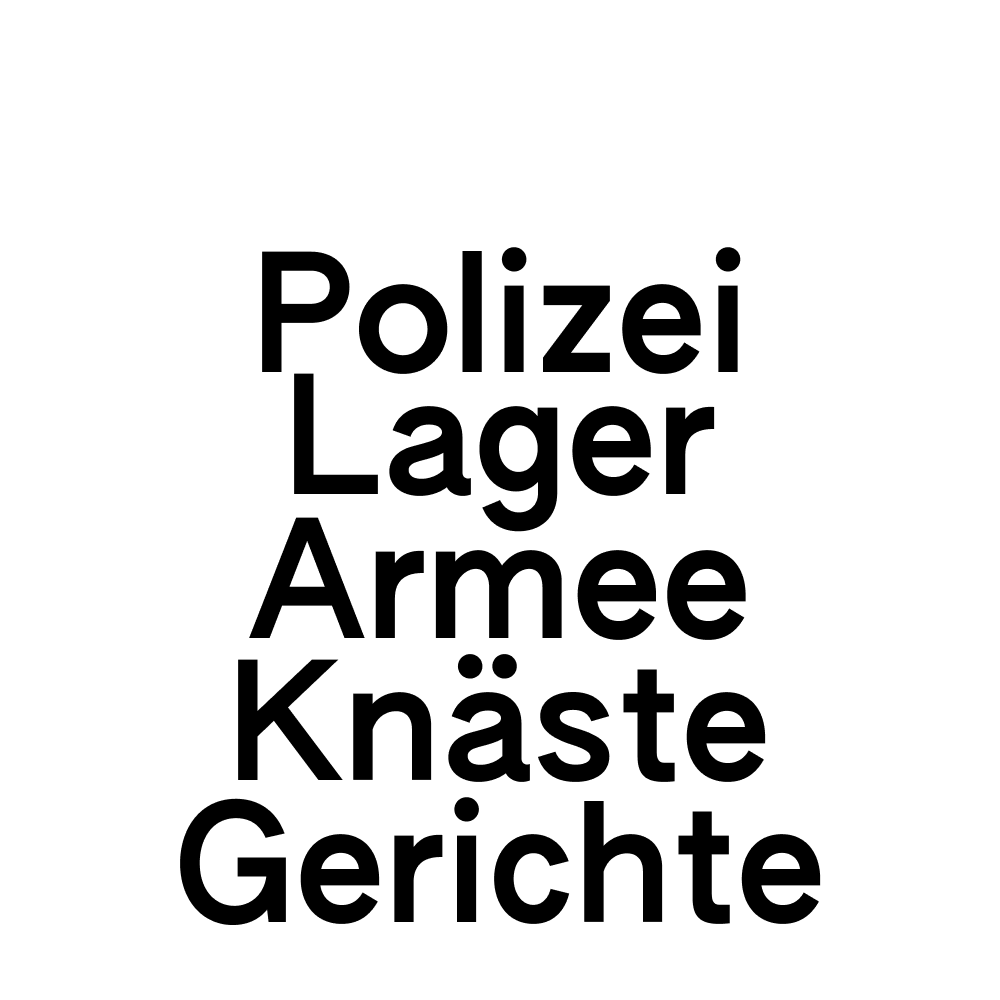
Station 1: Polizei
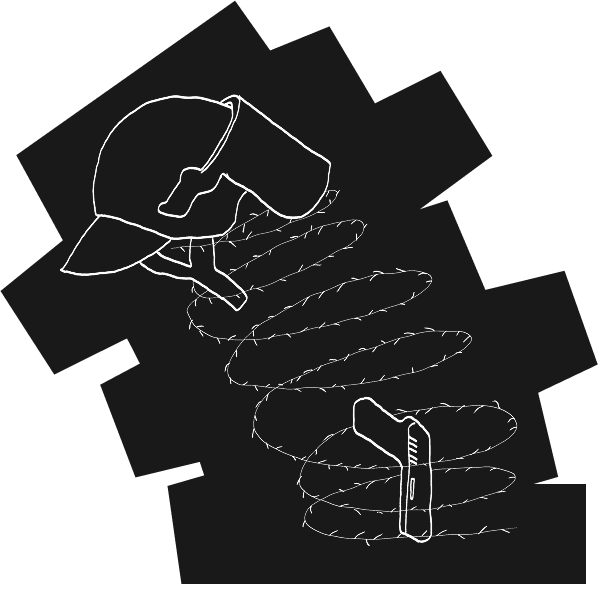
Station 1: Polizei
Viele unter uns mussten aufgrund der Polizei schlimme Erfahrungen machen. Im medialen Mainstream wird selten über die Gewalt berichtet, die von der Polizei ausgeht. Aber Polizeigewalt ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Polizei mordet, tötet, würgt, schiesst, teasert, pfeffert, prügelt, verhaftet, sperrt weg, schiebt ab, schränkt ein, verhindert, bestraft. Nebst der Gewalt, die sie ausübt, beobachtet und kontrolliert uns die Polizei ständig. Ohne uns danach zu fragen, liest sie uns ein: Auffällig oder unauffällig, gefährlich oder ungefährlich, kriminell oder nicht kriminell. Der Sicherheitsfokus spaltet und hierarchisiert uns. Dabei arbeitet die Polizei mit Vorurteilen. Sie ordet uns entlang von klassistischen, rassistischen, heterosexistischen, nationalistischen Merkmalen. Insgesamt hinterlässt die Polizei bei vielen wenig Gutes. Hass, Wut, Traumas, Trauer, Angst, Verunsicherung, Scham und Schuldgefühle.
Die Polizei bildet zusammen mit Armee, Geheimdienst, privaten Sicherheitsfirmen einen repressiven Apparat. Dieser will uns durch Zwang und Einschüchterung dazu bringen, die herrschende Ordnung zu akzeptieren. Neben dem repressive Apparat arbeitet zudem ein ideologischer Apparat. Zu diesem zählen Schule, bürgerliche Medien, Parteien, Intellektuelle oder Verbände. Der ideologische will uns über die Vermittlung von Ideen und Werte, dazu bringen, die Ordnung nicht nur freiwillig zu akzeptieren sondern quasi zu wünschen. Der repressive und ideologische Apparat erklärt, warum wir es so schwer haben, diese Ordnung zu destabilisieren und Alternativen aufzubauen.
Die Polizei sagt, sie sorge für Ruhe und Ordnung. Dabei betrachtet sie uns alle als potentielle Gefahr. Ihre Gewalt und Repression schützt nicht alle gleich. Sie schützt vor allem jene, die von der aktuellen Ordnung profitieren. Jene, die von Staat, Nation, Patriarchat und Kapital privilegiert werden. Eine Ordnung, die auf Unterdrückung, Ausbeutung, Diskriminierung und Zerstörung, auf Gewalt fusst. Eine Ordnung, die von uns lebt, doch unsere Leben und Lieben bedroht.
Die Polizei schützt nicht alle gleichermassen. Das erfahren diskriminierte Menschen und Gruppen am eigenen Leibe. Häufig werden ihre Aussagen nicht ernst genommen. Oder schlimmer: Wenn TINFAs die Polizei rufen, riskieren sie, dass die patriarchale Gewalt von Polizist*innen kleingeredet wird. Wenn rassifizierte Personen die Polizei rufen, riskieren sie, dass sie selbst von Polizist*innen als potentielle Täter*innen ins Visier genommen werden. Wenn illegalisierte Personen, die Polizei rufen, riskieren sie die Ausschaffung. armutsbetroffene Personen die Polizei rufen, werden sie riskieren sie Gewalt und Kriminalisierung. Ein anderes Problem ist, dass die Polizei in der Regel erst dann arbeiten will, wenn es zu spät ist. Also wenn Gewalt bereits passierte. Die Polizei arbeitet meist reaktiv nicht präventiv.
Können wir pauschal alle Polizist*innen kritisieren? Wir finden ja. Niemand muss Polizist*in werden. Mehr als einzelne Polizist*innen ist die gesamte Polizei das Problem. Insgesamt zieht der Beruf vorwiegend Menschen mit problematischen Vorlieben an. Menschen, die motiviert sind Tag für Tag mit Gewaltbereitschaft innerhalb einer stark hierarchischen Struktur für herrschenden Ordnung einzustehen. Es mag sein, dass sich unter diesen, auch Personen befinden, die eher helfen als bestrafen wollen, doch spätestens in der Ausbildung wird dafür gesorgt, dass auch diese Personen sich in Kultur der Polizei die sogenannte Copculture einfügen. Ein Ausbildner beschreibt das so: Die Ausbildung mache die angehenden Polizist*innen zu Wölfen. Wölfe leben im Rudel, das sie stark mache. Wölfe wüssten, wie sie sich in ein hierarchisches Ganzes einzufügen hätten, wüssten gegenüber wem sie gehorsam zu sein hätten. Sie würden die Autorität der Ranghöheren respektieren. Die Loyalität gegenüber dem Rudel sei überlebenswichtig. All das wird in der Ausbildung ein-trainiert, normalisiert und später im Beruf praktiziert. Hierarchie, Gehorsam, Korpsgeist. Dazu kommt eine ausgeprägte Schweigekultur: Polizist:innen, die mit dem toxischen Berufsalltag nicht einverstanden sind, begehren nur selten auf. In der Basler Kantonspolizei gibt es dafür einen eigenen Begriff: Wer Fehlverhalten meldet, gilt als «Ratte» – und wird isoliert.
Theoretisch müssten Polizist*innen desertieren und zu uns überlaufen.Jeden Tag könnten Polizist*innen feststellen, was der Kapitalismus, das Patriarchat und der Rassismus anrichtet. Jeden Tag sind Polizist*innen mit armutsbedingter Kriminalität, mit patriarchaler Gewalt, unterschiedlichsten Formen von entmenschlichendem Rassismus konfrontiert. Jeden Tag könnten die Polizist*innen entdecken, dass hinter den kriminalisierten Verhaltensweisen meist die herrschende Ordnung steckt. Jeden Tag könnten Polizist*innen begreifen, dass ihre Repression oder ihre Bestrafungen, ihre ständige Gewalt, kaum Wirkung erzielt und erst recht keine Lösung darstellt.
Statt nach links tendieren Polizist*innen extrem nach rechts. Viele Polizist*innen fühlen zum Faschismus hingezogen. Regelmässig werden innerhalb der Polizei faschistische Netzwerke oder Chatgruppen aufgedeckt. Faschismus und Polizei scheinen kein Widerspruch zu sein, im Gegenteil. Der Faschismus analysiert die aktuelle Gesellschaft als kaputt. Für mehr Ruhe und Ordnung fordert der Faschismus noch mehr Gewalt und härtere Bestrafungen. Um sauberzumachen brauche es mehr Verbote, eine härtere Gangart, quasi Krieg, um endlich aufzuräumen. Solche Ideen sprechen Polizist*innen offensichtlich an.
Kein Wunder, haben unsere Prozesse gegen die Polizei kaum Chancen. Bei rassistischen Polizeimorden, bei Racial Profiling, bei übergriffigert Gewalt gegen Protestierende gehört für Polizist*innen zum Job. Fehlerkultur bei der Polizei heisst, Fehler zu leugnen. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren decken sich Polizist*innen gegenseitig. Das ist Teil des Jobs. Wer sich im Rudel einfügt und für dieses sogar tötet, soll im Gegenzug keine Sanktionen befürchten – so in etwa der Deal. Und wer es wagt, gegen die Polizei vorzugehen oder sie sogar anzuklagen, muss damit rechnen von ihr runter gemacht zu werden und eine Gegenanzeige zu kassieren.
Obwohl sie schrecklich ist, übt die Polizei auf viele Kinder eine Faszination aus. Besonders für Jungs ist die Polizei ein Traumberuf. Auch später behalten viele ein gutes Bild von der Polizei, obwohl immer wieder von gravierenden Problemen mit Rassismus, Klassismus, Patriarchat der Polizei die Rede ist. Das hängt mit der Funktion der Polizei zusammen. Der Funktion, die sie in der aktuellen Gesellschaft ausübt. Die Polizei steht für Sicherheit und Recht. Wir können sie zwar ablehnen, doch im Hier und Jetzt kommen wir nicht immer um sie herum. Bei einem Autounfall liegt es nahe sie aus versicherungstechnischen Gründen zu rufen. Bei Gewalt sind wir auf sie angewiesen, wenn wir oder unsere Strukturen nicht selber eingreifen können oder wollen. Bei einem Todesfall müssen wir sie rufen, um nicht auffällig zu wirken. Im Alltag ist die Polizei das Aushängeschild des Staates. Sie verkörpert ihn. Sie zeigt auf, dass der Staat immer da ist. Dass wir unsere Konflikte nicht ohne ihn regeln sollen.
Abolitionismus will die Polizei abschaffen, um Platz für solidarischere sicherere Verhältnisse zu schaffen. In dem Sinne schützt die abolitionistische Polizeikritik vor zu kurz greifenden Analysen und Forderungen. Das Polizeiproblem liegt nicht beim Einzelfall, sondern bei der Polizei als Institution. Die Polizei ist nicht reformierbar, daher braucht es weniger und nicht mehr Geld für die Polizei. Forderungen nach mehr Ressourcen und Bildung für die Polizei fördert ihr Legitimation. Abolitionistische Alternativen zur Polizei verabschieden sich von der Idee der Sicherheit durch Kriminalisierung, Repression und Bestrafung. Sicherheit entsteht, wenn wir Herrschaftssysteme überwinden. Wenn Verteilung und Anerkennung auf Gleichheit statt Ungleichheit basiert. Wenn es logischer ist sich solidarisch, inklusionsorientiert und kooperativ statt exklusionsorientiert und mackrig zu verhalten. Wenn Konfliktlösung und das Verhindern von übergriffiger Gewalt nicht spezialisierten Rambos überlassen wird, sondern eine gemeinsame Aufgabe darstellt. Wenn die Frage, «was uns wirklich sicher macht» zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Bildung, Praxis und Communities wird.
Station 2:
Lager
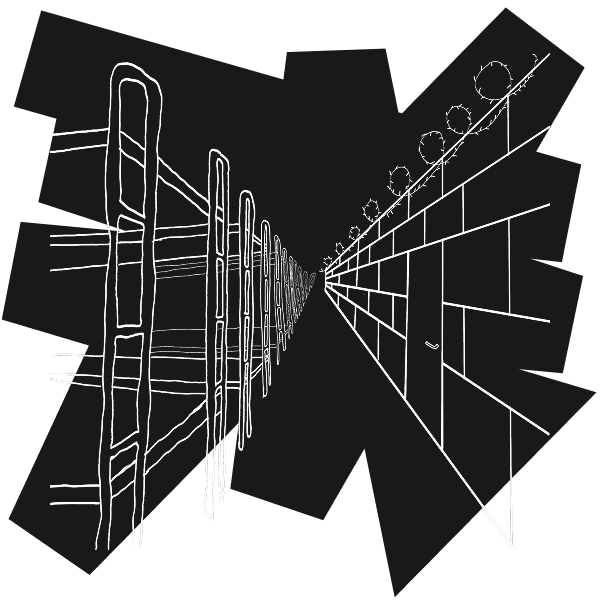
Station 2: Lager
Asyllager sind wichtiger Bestandteil der rassistischen europäischen Migrations- und Grenzpolitik. Wer Lager baut und verwaltet, will Flüchtende und Migrant*innen darin verwahren, um sie vom Territorium Europas abzuhalten, um sie zu deportieren, von wo sie geflüchtet oder migriert sind. Lager sind Orte der Kontrolle, der Festsetzung der Personen, der Verhinderung von Bewegungsfreiheit, der Raubung von Lebenszeit. Wer in einem Lager leben muss, wird von dessen Strukturen zermürbt, zum Nichtstun verdammt, erniedrigt, immobil und tatenlos gemacht.
Die Grenzen Europas werden einerseits externalisiert, in dem Geflüchtete in Lagern ausserhalb der europäischen Grenze oder an der Grenze festgesetzt werden. Die EU und Italien haben beispielsweise seit Jahren einen Deal mit Libyen. Geflüchtete werden von der lybischen Küstenwache auf dem Mittelmeer abgefangen und nach Libyen zurückgeschafft. In Lager mit schaurigen Bedingungen. In sogenannten Closed Controlled Access Centres (CCAC) wie in Samos leben Perosnen in überbelegten Räumen, unter einem strengen Beschränkungs- und Überwachungssystem mit doppeltem Stacheldrahtzaun. Es bestehen digitale und physische Sicherheitsinfrastruktur und einer 24/7-Präsenz von patrouillierenden Polizist*innen und privaten Sicherheitskräften. Geflüchtete werden in diesen Camps «sortiert» – die laut Europa nicht asylwürdigen bleiben inhaftiert oder werden ausgeschafft.
Innerhalb Europas sind Lager Knotenpunkte der Grenzziehungen. Sie dienen dazu, Menschen – die als überflüssig gelten – aus der Gesellschaft auszuschliessen, indem sie eingeschlossen werden. Im Jahr 2024 wurden 30000 Asylgesuche gestellt. Alles Menschen, die in die Bundysasyllager mit Kapazitäten von 5000 Plätzen oder in kantonalen Lagern untergebracht werden. Zudem leben rund 3000 Menschen in (Stand 2022) in Nothilfelagern, illegalisiert und völlig entrechtet. Minimal der Standard. Maximal die Kontrolle: Ein extremes Beispiel ist ein Camp in Kaltbach, Schwyz, wo abgewiesene Geflüchteten nur nachts in Container dürfen. Dieser wird am Morgen geschlossen.
«Wir alle sind in der Containerunterkunft im Chaltbach untergebracht. Dort können wir jeweils nur die Nacht verbringen und müssen dann tagsüber von 9:30 bis 19:00 unsere Zeit irgendwo draussen verbringen. Jeden Abend und auch morgens müssen wir unsere Anwesenheit im Container mit unserer Unterschrift bezeugen. Nur wer unterschrieben hat, bekommt 10.– pro Tag. Keine Unterschrift – kein Geld. Mit diesen 10.– müssen wir uns Essen, Kleidung und Hygieneartikel und auch das Handyabo kaufen. Es ist uns untersagt, zu arbeiten um etwas Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Wir sind gezwungen an öffentlichen Plätzen rumzuhängen, in Shoppingzentren ein warmes oder trockenes Plätzchen zu suchen. Oft sind wir feindseligen und rassistischen Bemerkungen ausgesetzt. Diese hoffnungslose Situation ist psychisch und auch physisch sehr belastend. Wir sind hier unerwünscht, wir sollen verschwinden, in die Illegalität abtauchen, zurück in die Heimat, wo es sein kann, dass wir von einem totalitären Regime inhaftiert, gefoltert oder sogar getötet werden.»
Lager sind totale Institutionen. Das kann in Anlehnung an den Soziologen Erving Goffman gesagt werden. In totalen Institutionen herrscht eine bürokratische Organisation, bestimmt durch Hausordnungen und Regeln. Diese Organisation muss reibungslos laufen, effizient sein und keine Störungen beinhalten. Die Totale Institution der Lager ist gekennzeichnet durch den Verlust von Privatsphäre, durch strikte, nicht gut nachvollziehbare Regeln, Anwesenheitspflichten, einem System von impliziten Belohnungen (wenn man gehorcht) und Bestrafungen (wenn man sich nicht an die Regeln hält). Die Geflüchteten sind dauernden Angriffen auf ihr Selbst ausgesetzt: Erniedrigungen, Degradierungen, Demütigungen und Entwürdigungen. Menschen in Lagern haben keine Möglichkeit zur Selbstbestimmung und individuellen Gestaltung ihres Lebens.
Lager als Teil der Todespolitik. Sie zielen auf soziale, zivile und gesellschaftliche Tode ab, so die Abolitionistin Vanessa Thompson. Damit sind nicht nur der physische Tod gemeint, sondern auch der soziale Tod. Es sind die kleinen und langsamen Tode durch Ausschluss vom Leben, durch Ausschluss aus dem, was Leben ausmacht: Bewegungsfreiheit, soziale Beziehungen, Rückzug in eigene Räume, das Recht auf Bildung, Gesundheit, Würde und ein selbstbestimmtes Leben.
Lager erfüll(t)en historisch bereits verschiedene Zwecke. Sie gehen auf den Ursprung des kolonialen Kapitalismus zurück. Menschen wurden in den kolonisierten Gebieten durch die europäischen Nationalstaaten einerseits in Lager gesteckt, um ihre Arbeitskraft auszubeuten. Andererseits dienten die Lager der Kontrolle der Bevölkerung. Sie waren Disziplinierungs- und Bestrafungsorte aber auch Stätten der Erziehung (und damit Unterwerfung). Sie waren Todesorte, weil viele Menschen auf engen Räumen und den schlechten Bedingungen an Krankheit oder Schwäche starben. Auch aktuell stellen Lager Orte der Dehumanisierung und Entwürdigung dar.
Unser Ziel ist es die Lager der kleinen und realen sozialen Tode abzuschaffen. Aber nicht nur durch deren Zerstörung, wie die Abolitionistin Harsha Walia erklärt. Es geht gleichzeitig um die Schaffung von Strukturen, Institutionen und Räumen, in denen Menschen sicher ankommen können, sich frei bewegen und selbstbestimmt leben können. Es geht um gemeinsame Räume des Lebens statt einer Politik des Todes.
Station 3: Armee
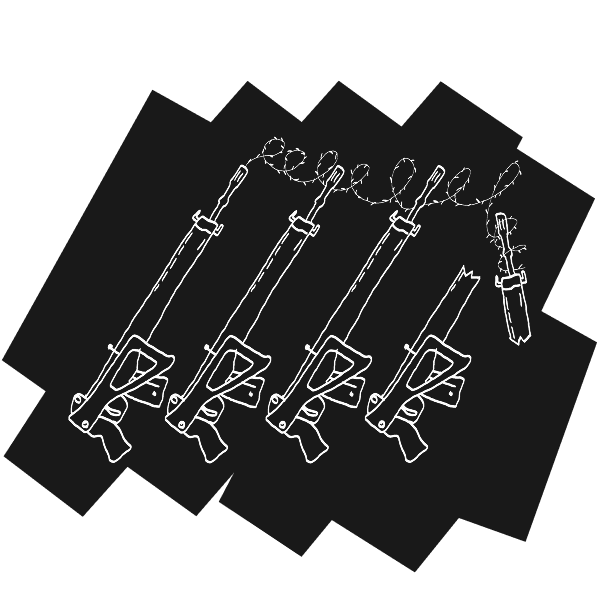
Station 3: Armee
Wir stehen nun vor einer Kaserne. Die Armee erlebt in Europa ein grosses Comeback. Die Armeebudgets explodieren. Die Rüstungsexporte auch. Verstaubte Generäle aus Zeiten des kalten Krieges dürfen wieder als Experten der Welt erklären, was Sicherheit heisst: Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Wer heute den Frieden wolle, müsse wehrhaft werden und bereit sein in den Krieg zu ziehen.
Die Gegenwart ist von tiefgreifenden Umwälzungen geprägt. Fronten und Blöcke, Krieg und Genozid dominieren die globale Bühne. Die Ordnung der Staaten nimmt vor unseren Augen neue Formen an. Aktuell wird die westliche Vormachtstellung durch andere imperialistische Mächte wie Russland, China und Indien in Frage gestellt. Das zeigt der Angriffskrieg auf die Ukraine. Das zeigt sich in Gaza, wo der israelische Staat einen Genozid gegen Palästinänser*innen begeht. Das zeigt sich in Indien, wo die Modi Regierung einen Krieg gegen Pakistan sucht. Das zeigt sich auch in der Türkei unter dem faschistischen Erdogan Regime und seinen Angriffen auf die kurdischen Gebiete. Es scheint als wollten die autokratischen Regierungen ausloten, wie viel sie sich von anderen Staatgebieten aneigenen können. Es scheint als seien wir unterwegs in den nächsten Weltkrieg.
Die Kriege sind in erster Linie Verteilkämpfe. Hinter den feurigen Reden, die uns aufrufen, hinter die eine oder andere Seite zu scharren, stehen Interessen und Kämpfe zwischen Staaten und unterschiedlichen politischen oder wirtschaftlichen Fraktionen der Herrschenden. Es geht um Verteilkämpfe um Energie, um Zugang zu Ressourcen, um Verteilkämpfe um Kontrolle von Macht. Die Mehrheit hat nie Interesse an Krieg. Die Mehrheit leidet unter Krieg. Die Mehrheit kann im Krieg fast nur verlieren, während die Reichen und Mächtigen davon profitieren. Wir und nicht sie sterben im Krieg.
Vor dem Krieg kommt das Aufrüsten und Wettrüsten. Beides hat längst begonnen. Lange sanken die Armeeausgaben, nun steigen sie wieder rasant an. Um die sogenannte «Verteidigungsfähigkeit» wiederherzustellen, werden in der Schweiz 13 Milliarden CHF für die Armee gefordert. Die Profiteure dieses Wettrüstens sind Grossunternehmen wie UBS. Durch ihre Investitionen in Rüstungsfirmen wie Lockheed Martin, Boeing, Raytheon oder Rheinmetal erziehlt die UBS hohe Profite. Wenn mehr Waffen, Munition, IT- Systeme usw. bestellt werden, profitiert natürlich auch die RUAG,
Entscheidend für Krieg ist meist der Nationalismus. Für die Interessen der Kapitalist*innen greifen die wenigsten zur Waffe. Es braucht meist eine feurige Begeisterung für eine vermeintliche Gemeinschaft zu der sich Menschen zugehörig fühlen. Diese wird durch Nationalismus geschaffen. Meist wird gesagt, wiederhohlt unnd gepredigt, dass vermeintliche Errungenschaften wie Sicherheit, Reichtum, die Demokratie, die Werte oder Menschenwürde der eigenen Nation bedroht seien. Bedroht von vermeintlichen Feinden der eigenen Nation. Diese seien von Natur aus nur böse und brutal und sonst wie schlecht. Solche Argumente werden ins Feld geführt, um uns ins Feld zu führen. Leider scheint dies gerade im grossen Stil zu gelingen. Der Nationalismus hat weltweit extrem zuspruch.
Für Kriege braucht es Soldat*innen, die bereit sind zu töten. Es braucht Menschen von uns, die in die Lage versetzt werden bei Gräueltaten des Kriegs mitzumachen. In Kasernen wie hier geht es darum, dies zu lernen. Es geht nicht darum, wie Frieden geschaffen wird. Es geht um Krieg. Die Schweizer Armee gibt sich gerne als eine demokratische Institution mit zivilen Aufgaben und ausschließlich verteidigender Ausrichtung. Doch die Schweiz beteiligt sich aktiv an NATO-Programmen und hat erst kürzlich, im April 2025, eine gemeinsame Übung mit NATO-Armeen in Österreich durchgeführt. Das woführ sie Trainierten zeigt sich im Jemen, in Mali, Afghanistan oder Rojava. Sprich in allen Kriegen, an denen sich europäische und NATO-Staaten beteiligen. Was in Kasernen wie hier vermittelt wird, verstaubt nicht in Regalen. Es kommt zur Anwendung.
Station 4: Knäste
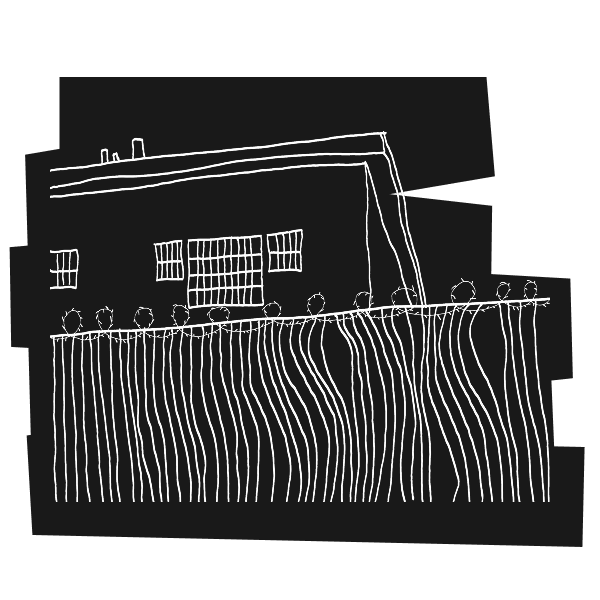
Station 4: Knäste
Viele in dieser Stadt wissen gar nicht, dass wir uns hier vor einem Gefängnis befinden. Auch jene, die es wissen, kennen die Realität hinter diesen Mauern nur selten wirklich gut. Hingegen befürworten fast alle die Existenz von Gefängnissen. Sie tun dies ohne zu zögern. Doch stell dir vor, dir wird von einem Tag auf den nächsten die Kontrolle über dein Leben genommen. Andere bestimmen, wann du isst, wann du schläfst, wann du andere Menschen triffst oder nicht triffst, ob Bücher lesen darfst. Stell dir vor, es gäbe Menschen die du jeden Tag sehen musst, von denen du abhängig bist und die dich jederzeit verprügeln können – und die das auch tun.
Gefängnisse sind bewusst grausam gestaltet. Sie stellen eine der gefährlichsten Waffe des Staates dar. Die Isolation soll Menschen bestrafen, brechen und neu formatieren. Wer sich nicht fügt, riskiert lebenslang weggesperrt zu werden. Wer sich «bewährt» wird eventuell mit «frühzeitiger Haftentlassung» belohnt. Gefängnisse sind auch eine Botschaft an alle nicht-isolierten. Sie sind ein Mahnfinger des Staates. Alle sollen sich an die herrschende Ordnung anpassen und sich ihr fügen.
Jedes Gefängnis ist ein Tatort. Regelmässig sterben inhaftierte Menschen. Die schweizer Suizidrate im Gefängnis ist viermal höher als der europäische Durchschnitt. Über die Verstorbenen, ihre Leben und ihr Ableben wissen wir zu wenig. Doch es wäre verkürzt von tragischen Einzelschicksalen auszugehen. Jedes Leben und Sterben im Gefängnis hat mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun. Besonders oft isoliert, werden Menschen, die von Armut, Rassifizierung, Suchtkrankheiten, Wohnungslosigkeit und Gewalt betroffen sind. Diese Personen sind allgmein eher verletzlich. Durch das Gefängnis kommen zusätzliche Belastungen dazu. Beim Haftbeginn kommt es meist zu einem Schock. Isolation, Kontrollverlust und Perspektivlosigkeit schaden der Psyche. Wer Suchtkrank ist, muss mit einem ungenügend begleiteten Entzug fertig werden. Schädlich wirken auch schlechten Hygienestandards und ungenügende Gesundheitsversorgung. Auch die Gewalt durch die Polizei, Wachpersonal oder andere Insass*innen sind ein Risiko.
Jede Haft ist schädlich. Die Haftregime reichen von Untersuchungshaft, über den Strafvollzug und den Massnahmevollzug bis hin zur Administrativhaft. Jede davon ist schädlich. Schauen wir uns die Untersuchungshaft genauer an. Untersuchungshaft, wird theoretisch nur bei dringendem Tatverdacht angeordnet und muss möglichst kurz sein. Die Realität ist anders. Insbesondere bei illegalsierten Menschen wird unhinterfragt von Fluchtgefahr ausgegangen. Oft dauert die sogenannte U-Haft unmenschlich lange. Die unerträgliche Ungewissheit über die Dauer der U-Haft zermürbt. Theoretisch sollten die Betroffenen die gleichen Rechte, wie andere Gefangene haben: Zugang zu Arbeit, Beschäftigung und Kontaktmöglichkeiten und sogar das Recht auf Resozialisierung. Auch diese Rechte werden systematisch missachtet.
Inhaftierte Personen werden überausgebeutet. Arbeitsrechtliche Bestimmungen gelten im Gefängnis nicht. Die Bezahlung ist lächerlich niedrig. An vielen Orten dieser Welt wird für die Arbeit gar nicht bezahlt. In den USA werden Gefängnisse meist von gewinnorientierten Unternehmen geführt. Diese Firmen würden Bankrottgehen, würden ihnen nicht ständig neue billige arbeitende Häftlinge zugeführt. Diese Überausbeutung verlängert sich nach der Haft. Vielen finden kaum mehr Arbeit, weil sie im Gefängnis waren. Die Vorurteile von Menschen, die schon einmal im Gefängnis waren, sind stark. Viele wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Daher müssen exinhaftierte schlecht bezahlte Jobs annehmen.
Gefängnisse in der Schweiz sind massiv überfüllt. Für Behörden, bürgerliche Politiker*innen und den medialen Mainstream sei die Überbelegung auf die steigenden Kriminalität in der Schweiz zurückzuführen. Diese wiederum sei auf die nationale Herkunft zurückzuführen. Das sind jedoch rassistische Narrative. Ob die Kriminalität tatsächlich zugenommen hat, lässt isch nicht einfach feststellen. Steigende Zahlen könnte auch ein Hinweis sein, das mehr Delikte angezeigt werden, von der Polizei ins Visier genommen werden oder ob neue Verhaltensweisen unter Strafe gestellt werden oder strengere Strafen ausgestellt werden. Die Kriminalitätsrate wird nicht differenziert analysiert. Es scheint mehr darum zu gehen ein rassistisches Angstklima zu erzeugen und die staatliche Repression zu rechtfertigen. Der Überbelegung könnte entgegengewirkt werden, indem auf Ersatzhaftstrafen verzichtet würdewerden. Ersatzfreiheitsstrafen isolieren Menschen, wenn sie beispielsweise Bussen nicht bezahlen können. Doch anstatt die Notbremse zu ziehen, wird Leid und Tod in Kauf genommen.
Gefängnisse sind kein Fehler im System, sie sind vom System gewollt. Sie sind kein Missverständnis. Deshalb sind auch nicht reformieren oder menschlich gestalten. Für radikale Abolitionist*innen ist klar: Wenn Gefängnisse nicht kaputt sondern vom System gewollt sind, können sie auch nicht repariert werden. Gefängnisse müssen deshalb überwunden werden. Gebäude sollen abgerissen werden. Die sozialen Bedingungen, die sie möglich und nötig machen auch. Es braucht neue Formen der Sicherheit, die die Gefängnisse nicht mehr unvermeidlich erscheinen lassen.
Station 5: Gericht

Station 5: Gericht
Das Gebäude, vor dem wir uns nun befinden,ist ein Gericht. Hinter diesen Mauern erhalten die einen die Macht über andere zu richten. Im Namen des sogenannten Volkes. Im Namen des Gesetzes wird hier über Schuld und Unschuld entschieden. Die einen werden freigelassen und andere weggesperrt. Die einen erhalten Recht. Andere werden bestraft. Viele von uns mussten bereits schmerzhaft erfahren, inwiefern Gerichte Schicksalsorte sein können. Orte extremer Macht, Herrschaft und Gewalt. Hinter den sauber gekleideten Richter*innen, die in den properen Gerichtssälen in aller Ruhe ihre Urteile fällen, steckt ein riesiger repressiver Apparat aus Polizei und Knästen. Ein Gewaltapparat den wir ablehnen und aufheben wollen.
Der Satz: «Vor Gericht sind wir alle gleich», entpuppt sich schnell als Mythos. Vor Gericht existiert höchstens formale Gleichheitbehandlung, jedoch nicht reale Gleichheit. Das Verbot Häuser zu besetzen gilt gleichermassen für eine Bankdirektorin wie auch für einen Sans-Papiers. Das Recht, als Hauseigentümer*innen alle Mieter*innen auf die Strasse zu stellen steht sowohl der Bankdirektorin wie auch dem Sans-Papiers zu. Es zeigt sich schnell, wie formale Gleichheit die realen Ungleichheiten ignoriert.
Sind Gerichte gerecht? Wenn Gerichte richten und Verhaltensweisen in kriminell einstufen und Menschen schuldig sprechen, hat das nur am Rande mit Gerechtigkeit zu tun. Im Kern ist das Recht das Ergebnis von politischer Entscheidungen. Der momentane Kristallisationspunkt der Kräfteverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die von massiven Ungerechtigkeiten geprägt ist, tragen die Gerichte dann auch zur Aufrechterhaltung dieser Ungerechtigkeiten bei. Deshalb heisst es auch: Das herrschende Recht ist das Recht der Herrschenden.
Rassismus, Kapitalismus oder Patriarchat haben vor Gericht nichts zu befürchten. Vor Gericht zeigt sich, wessen Interessen geschützt werden und welche Bedürfnisse nichts zählen sollen. Das Bedürfnis des Sans-Papiers nach einer Wohnung zählt weniger als das Interesse der Bankdirektorin ihre Profite zu maximieren.Eine armutsbetroffene Person, die im Aldi Essen klaut, im Tram ohne Ticket mitfährt oder ohne Papiere lebt, wird bestraft. Eine reiche Person, die Arbeiter*innen ausbeutet, Mieter*innen verdrängt oder die Umwelt zerstört, nicht.
Schuldig sind vor einem Gericht immer nur Einzelne nie aber die Strukturen. Gerichte bestrafen Armutsdelikte und wälzen die Schuld auf Einzelne ab. Nach sozialen Ursachen der Taten fragen sie nicht. Gerichte verurteilen einzelne Männer für Feminizide, das Patriarchat jedoch bleibt straffrei. In ganz seltenen Fällen werden vor Gericht rassistische Polizist*innen schuldig gesprochen. Diese gelten dann aber als Ausnahmeerscheinung und nicht Ausdruck der Regel. Gerichte sehen keinen Rassismus der Polizei. Strukturen der Herrschaft bleiben vor Gericht unangreifbar.
Ohne Gerichte könnte der Kapitalismus wohl nichtfunktionieren. Um sich Marktvorteile zu verschaffen, würden sich die Kapitalist*innen gegenseitig beklauen und angreifen. Jede Firma bräuchte eine Armee. Wie bei der Mafia würde Konkurrenz regelmässig in Gewalt umschlagen. Das Privateigentum, das Herz der Kapitalist*innen wäre ständig gestresst. Der Markt braucht einen Schiedsrichter. Auch wenn ein Gericht ab und zu gegen einzelne Kapitalist*innen urteilen mag, insgesamt stellen Kapitalist*innen die Gerichte, das Recht und das Gewaltmonopol des Staates nicht in Frage.
Wir können uns dem Recht fast nicht entziehen. Das Recht erfasst fast alles, was wir sind und haben. Die gesamte Gesellschaft bewegt sich in einer unendlichen Kette von Rechtsverhältnissen. Hinter jeder Ware, jedem Kauf, jeder Beziehung steckt ein Rechtsverhältnis. Ob aufgrund von Kontrolle, Zwang und aus Angst vor Repression: Die Wirkung des Rechts, erfasst uns. Wir können das Recht zwar kritisieren, trotzdem ist es – ähnlich wie Geld – allgegenwärtigund unumgänglich. Eine befreite Gesellschaft muss daher nicht nur Polizei, Militär, Knäste und Camps abschaffen, sondern auch das Rechtswesen als einengende unterdrückerische Form.
Was macht die Welt sicherer? Menschen seien an sich böse oder gefährlich – deshalb brauche es Gesetze und Strafen. So die Erklärung. Doch sind wir Menschen nicht vorwiegend das Ergebnis von Erfahrungen und geprägt von Lebensumständen? Wenn wir uns in einer Gesellschaft entwickeln könnten, in der alle Zugang zu guten Lebensbedingungen haben, in der es um solidarische Kooperation statt um ausschlussorientierte Konkurrenz ginge, in der gewaltvolle Unterdrückungsverhältnisse abgebaut statt aufgebaut würden, brächte es wohl was ganz anderes als heute. Trotzdem wären wohl auch in einer befreiten Gesellschaft nicht alle von sich aus nur respektvoll. Auch in befreiten Gesellschaften wird es Konflikte und übergriffige Gewalt geben.
Der Abolitionismus schlägt vor, die Frage «Was macht uns wirklich sicher» heute statt morgen anzugehen. Ausgehend von der Erfahrung, dass Gerichte und Polizei, Knäste und Gefängnisse keine Sicherheit schaffen, müssen sicherere Alternativen her. Viele Ansätze für alternative Sicherheiten wurden zentral von Schwarzen und Indigenen Feminist*innen erdacht, die sich auf staatliche Sicherheit nicht verlassen konnten. Die vorgeschlagenen Strukturen sind bewusst unabhängig von staatlichen Institutionen. Sie basieren darauf, dass alle in einer Gemeinschaft lebenden Personen sich freiwillig daran beteiligen und den gemeinsamen Grundsätzen informiert zustimmen. Es geht darum die Idee zu überwinden, dass Sicherheit vor allem Abwehr, Abstrafung und Abschottung von externen Gefahren bedeutet. Stattdessen liegt der Fokus bei Awarness, kollektiver Verantwortungsübernahme und transformativer Gerechtigkeit.
Awareness bedeutet bewusst und achtsam sein. Es geht darum Strukturen zu schaffen, die in akuten Situationen von übergriffigem Verhalten und Diskriminierung ansprechbar und handlungsfähig sind. Awareness-Konzepte benennen Rassismus, Patriarchat und Klassismus im Verhalten von Personen, Strukturen und Institutionen, um sie aktiv zu verändern. Im Fokus steht dabei die betroffene Person und ihre Wünsche.
Kollektive Verantwortungsübernahme oder «Community Accountability». Bei diesem Ansatz geht es darum, schon vor einer konkreten Gewaltausübung stabile Beziehungen und starke Gemeinschaften mit gemeinsamen Werten und Visionen aufzubauen. Auch Unterstützungsgruppen für betroffene und gewaltausübende Personen werden etabliert. Gewalt wird weniger als individuell, sondern mehr als systematisch verstanden.
Bei der transformativen Gerechtigkeit oder Transformative Justice handelt sich um einen gemeinschaftlich unterstützten Prozess. Die Gewalt ausübende Person soll Verantwortung übernehmen und ihr Verhalten und ihre Einstellungen dauerhaft verändern, anstatt bestraft oder ausgestossen zu werden. Dies beinhaltet, die Gewalt zu beenden und bedingungslos anzuerkennen. Die von Gewalt betroffene Person soll sich (wieder) sicher fühlen und ihr Leben selbstbestimmt führen können. Weil Gewalt als strukturell betrachtet wird, sollen die gesellschaftlichen Bedingungen refl verändert werden.